Ein Tag der Befreiung? Ein Tag zum Feiern? Statement zum 80. Jahrestag des 8. Mai 1945
Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 80. Mal. In unserem Statement lest ihr, warum der 8. Mai nicht nur Gedenk-, sondern auch Feiertag werden sollte.
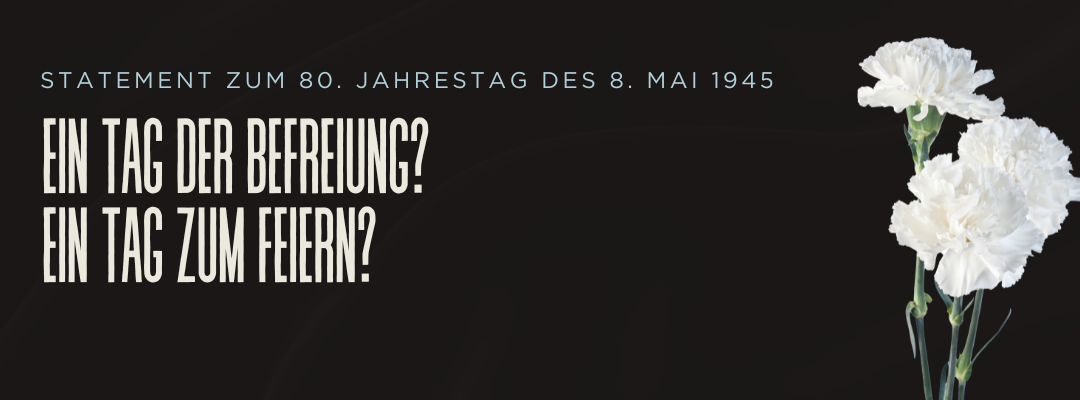
Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa – und damit das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft – zum 80. Mal. Mit beispielloser Gewalt und Vernichtungspolitik hatte der Nationalsozialismus ab dem 30. Januar 1933 zunächst Deutschland und spätestens ab dem 1. September 1939, dem Beginn des Überfalls auf Polen, sodann auch Europa und die Welt überzogen. Im Zentrum seiner Verbrechen stand der industriell organisierte Massenmord an sechs Millionen Jüdinnen*Juden. Zugleich wurden aber auch zahlreiche weitere Menschengruppen – Sinti*zze und Rom*nja, Slaw*innen, Homosexuelle, Kranke u. v. m. – verfolgt, entrechtet, deportiert, ausgebeutet und ermordet. Schätzungen zufolge kamen im Verlauf des Zweiten Weltkrieges über 65 Millionen Menschen zu Tode.
Für die Überlebenden von Vernichtungskrieg und Verfolgung bedeutete der 8. Mai das endgültige Ende des NS-Terrors – und für viele die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit und Würde. Doch trotz anhaltender Forderungen von Überlebenden des Holocausts und zivilgesellschaftlichen Initiativen ist der 8. Mai in Deutschland bis heute kein gesetzlicher Feiertag – ein Zeichen dafür, wie schwer sich die deutsche Erinnerungskultur nach wie vor mit der konsequenten Anerkennung und Würdigung der Opfer des Nationalsozialismus tut. Zwar wird der 8. Mai seit einer Rede vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985 vielerorts als „Tag der Befreiung“ benannt, doch es bleibt umstritten, wessen Befreiung hier überhaupt gemeint sein kann – und ob das Freiheitsversprechen historisch und gesellschaftlich jemals wirklich eingelöst wurde.
Denn: Für viele Überlebende der nationalsozialistischen Verbrechen war der 8. Mai 1945 zwar das Ende unfassbarer Gewalt, aber keineswegs der Beginn einer sicheren, gerechten oder solidarischen Gesellschaft. In unzähligen Fällen wurden ihnen Entschädigung, Anerkennung und Unterstützung nicht nur zu spät oder in zu geringem Maße, sondern nie gewährt. Antisemitische, rassistische und rechte Kontinuitäten blieben bestehen – in Behörden, in Schulen, auf der Straße. Diese Geschichte wirkt bis heute nach.
Ein Blick in die aktuellen Statistiken zur rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalt in Sachsen macht deutlich: Die Versprechen der Befreiung – Schutz, Gerechtigkeit, Teilhabe – sind bis heute nicht für alle Menschen eingelöst. Im Jahr 2024 dokumentierte die Beratungsstelle Support der RAA Sachsen insgesamt 328 rechtsmotivierte Gewalttaten. Das bedeutet einen Anstieg von über 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und den höchsten Wert seit 2018 – dem Jahr, als ein rassistischer Mob tagelang in Chemnitz marodierte. Besonders auffällig ist auch der sprunghafte Anstieg antisemitischer Straftaten seit dem 7. Oktober 2023 in Sachsen: Allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 wurden 150 antisemitische Straftaten registriert, während in den zehn Monaten davor 124 gezählt wurden, – eine Tendenz, die sich auch 2024 fortsetzte: Laut einer Pressemitteilung der sächsischen Landtagsfraktion von Die Linke ereigneten sich über das Jahr 2024 267 antisemitische Straftaten in Sachsen und damit die zweithöchste Anzahl seit Beginn der Erfassung.[i]
Diese Zahlen verbieten das Gerede von Einzelfällen – sie spiegeln eine Realität wider, in der Menschen täglich angegriffen, bedroht, beleidigt oder systematisch ausgeschlossen werden. Die Betroffenen erleben nicht nur physische und psychische Gewalt, sondern auch mangelnde gesellschaftliche Solidarität und zu häufig unzureichende institutionelle Reaktionen. Antisemitismus, Rassismus und rechte Gewalt sind keine Randerscheinungen – sie sind Ausdruck einer tief verwurzelten Ungleichheit, die unsere Gesellschaft weiterhin prägt.
Angesichts dieser Entwicklungen fordern wir mit Nachdruck: Der 8. Mai darf nicht auf ein symbolisches Gedenkritual reduziert werden. Er muss ein politischer Auftrag sein – zur ernsthaften Auseinandersetzung mit den historischen und gegenwärtigen Kontinuitäten rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Dieser Tag fordert uns auf, die Erinnerung an die Geschichte in gelebte Solidarität im Hier und Heute zu verwandeln. Es geht also um mehr als rückblickende Verantwortungsübernahme – es geht um die aktive Gestaltung einer Gesellschaft, die Ausgrenzung widerspricht, Vielfalt schützt und jedem Menschen gleiche Rechte, Sicherheit und Würde garantiert.
Daher geben wir uns mit der jüngsten Entscheidung der sächsischen Regierung, den 8. Mai zum Gedenktag zu erheben, nicht zufrieden: Der 8. Mai muss ein gesetzlicher Feiertag werden. Ein Tag, der allen Menschen und nicht nur politischen Repräsentant*innen Zeit und Raum bietet, die Opfer und Überlebenden zu würdigen, historische und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen öffentlich zu reflektieren und gegen gegenwärtigen Antisemitismus und Rassismus zu protestieren.
[i] Zur Einordnung: Die Anzahl der antisemitischen Straftaten entspricht der polizeilichen Eingangsstatistik. D.h., sie beinhaltet alle Fälle, die von oder gegenüber der Polizei als antisemitische Straftat angezeigt werden. Ob es sich im Enddefekt um eine antisemitische Straftat handelt, muss durch die weiteren Ermittlungen der Polizei sowie die Einschätzung von Staatsanwaltschaften und Gerichten überprüft werden. Eine Statistik darüber, wie viele der angezeigten antisemitischen Straftaten abschließend als solche gewertet werden, existiert unseres Wissens nach nicht. Die angegebene Zahl kann also nur als eine grobe Annäherung an die Realität verstanden werden.
