Jahresrückblick: Die Bündnisaktivitäten im Jahr 2024 auf einen Blick
Lest hier, was im vergangenen Jahr beim Bündnis gegen Antisemitismus in Dresden und Ostsachsen so los war.
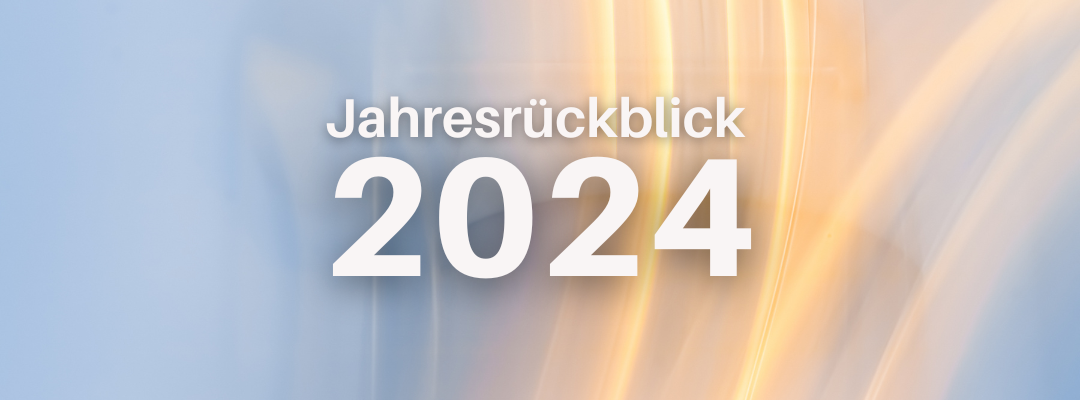
Im zweiten Jahr der Förderung durch das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ widmete sich das Bündnis weiter der Entwicklung und Erprobung eines modularen Workshopleitfadens, der aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus für die offene Jugendarbeit in Ostsachsen kritisch aufbereitet. Die Veröffentlichung des Leitfadens ist Ende 2025 geplant. Das zweite Projektjahr stand im Zeichen einer ersten Erprobung der Workshopkonzepte: In vier Workshops von Juni bis November konnten Fachkräfte der Jugendarbeit ihr Wissen über Antisemitismus und insbesondere zu sekundärem, israelbezogenem sowie verschwörungsideologischem Antisemitismus vertiefen und Handlungskompetenzen dagegen stärken. Gleichzeitig wurden die Workshopkonzepte auf ihre Tauglichkeit für die primäre Zielgruppe, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, hin überprüft. Begleitet wurde der Prozess durch regelmäßig stattfindende Arbeitstreffen mit den Bündnismitgliedern.
Im Vorfeld der praktischen Erprobung der Workshops widmete sich das Bündnis in zwei internen Weiterbildungen den pädagogischen Herausforderungen im Umgang mit Schuldabwehr- und Israelbezogenem Antisemitismus. In der ersten Weiterbildung erläuterte Dr. Olaf Kistenmacher den Schuldabwehr-Antisemitismus als Judenfeindschaft, die „nicht trotz, sondern wegen Auschwitz“ existiere und die wesentlich in der Umkehr von Täterschaft und Opferschaft nach dem Ende des Nationalsozialismus bestehe. Die besondere Schwierigkeit bei seiner Bearbeitung liege darin, dass der Schuldabwehr-Antisemitismus in tiefen psychologischen Vorgängen wurzele: Eine latente kollektive Erfahrung der Schuld werde rationalisiert und abgewehrt, um eine positive Identifikation des Einzelnen mit dem Kollektiv zu ermöglichen. Soll dieser Form des Antisemitismus erfolgreich begegnet werden, müssen diese Prozesse nachvollziehbar aufgearbeitet werden. Ohne eine intensive Arbeit an Beispielfällen könne dies nur schwer gelingen.
In der Weiterbildung von Vicky Lessing (Bildungsbausteine e.V.) wurde sich sodann dem Israelbezogenem Antisemitismus aus einer rassismussensiblen Perspektive genähert. Ihre Ausführungen begannen damit, dass Gefühlen im Lernprozess allgemein mehr Raum gewährt und konstruktiv begegnet werden müsse, gerade im Hinblick auf komplexe und hochemotionale Phänomene wie den Israel-Palästina-Konflikt. Ein Weg, dies zu ermöglichen, sei z.B. die Methode des Emotionskochtopfs. Eine weitere Empfehlung der Weiterbildung, die auch praktisch erprobt wurde, war das ALARM-/ALERT-Modell. Dieses biete gleich zwei Vorteile. Mithilfe der Akronyme des Modells könnten Aussagen im Kontext des Israel-Palästina-Konflikts zum einen einfach auf antisemitische sowie rassistische Gehalte überprüft werden. Zum anderen erkenne das Modell aber auch unmittelbar die beidseitigen Anfeindungen und Diskriminierung im Israel-Palästina-Konflikt an, was – im Gegensatz zu einer einseitigen Parteinahme im Konflikt – eine Auseinandersetzung mit der Diskriminierung „des Anderen“ mit unter überhaupt erst ermöglichen könne.
Die Bildungsarbeit des Bündnisses beschränkte sich 2024 aber nicht nur auf die Bündnismitglieder und die primären Projektzielgruppen: Am 10. Juli widmete sich ein öffentlicher Vortrag in Dresden den historischen und ideengeschichtlichen Hintergründen der Staatsgründung Israels. Und am 21. November hielt Andrejs Zacarinnijs vom Museum des Rigaer Ghettos und Holocaust in Lettland einen Vortrag zu den historischen Verbindungen zwischen dem Ghetto Riga und dem Alten Leipziger Bahnhof in Dresden – Riga war das erste Ziel der Deportation von Dresdener Jüdinnen*Juden 1942 – sowie über die Geschichte des Rigaer Ghettos, den Holocaust in Lettland und das Gedenken heute.
Dem gegenwärtigen Antisemitismus widmete sich das Bündnis unter anderem in einer Veröffentlichung zur Auswertung der polizeilich erfassten antisemitischen Straftaten in Sachsen 2023. Deutlich zeigte sich in den Daten die Zäsur des 7. Oktobers 2023: Antisemitische Straftaten nahmen sprunghaft zu, über die Hälfte der aufgenommenen Delikte wurden in den nicht einmal drei Monaten danach begangen. Unter anderem veranlasste diese quantitative Zunahme des Antisemitismus das Bündnis, sich auch in Form öffentlicher Versammlungen zu positionieren. Neben einer Mahnwache im Gedenken an den Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 organisierte das Bündnis am 13. Oktober, gemeinsam mit anderen Vereinen und Initiativen, eine Solidaritätsdemonstration mit Jüdinnen*Juden anlässlich des ersten Jahrestages des Angriffs der Hamas auf Israel.
Darüber hinaus war das Jahr 2024 in Sachsen auch ein sog. Superwahljahr: Mit der Initiative #SolidarischWählen rief das BgA-Ostsachsen gemeinsam mit dem Bündnis gegen Rassismus Sachsen dazu auf, bei der eigenen Wahlentscheidung die Stimmen der von Antisemitismus und Rassismus Betroffenen zu berücksichtigen. Dazu wurden sieben Interviews veröffentlicht, in denen Betroffene sowie ihre Unterstützer*innen aus der Zivilgesellschaft zu Wort kamen.
Im Kampf gegen das geschichtsrevisionistische Transparent mit der Aufschrift „Bombenholocaust“, das am 13. Februar 2022 auf einer Neonazidemonstration in Dresden gezeigt wurde, gab es 2024 einen herben Rückschlag: Auch die Generalstaatsanwaltschaft Dresden verweigerte, das Transparent und seine Urheber*innen vor Gericht zu bringen. Das Bündnis ist jedoch fest entschlossen, auch weiterhin gegen diese Herabwürdigung der Opfer des Nationalsozialismus vorzugehen.
